Hallo Holger,
solche Aussagen halte ich persönlich für sehr schwierig. Gerade beim längeren, unverblindeten Hören hast Du wieder die volle Bandbreite der Psychoakustik am Start:
- du siehst das Gerät
- du bedienst es
- du kennst die Testberichte
- du willst vielleicht sogar, dass es sich besser anhört
- usw.
Das Gehirn kann einem dabei eine Menge Streiche spielen.
Ausgepegelte Blindtest sind sicher kein Allheilmittel. Man muss sie aber auch nicht unter Zeitdruck und im Akkord durchführen. Wenn man sich dabei Zeit lässt, sollten solche eklatanten Unterschiede wie Du sie nennst, schon erkennbar werden.
Wenn das absolut nicht der Fall ist, dann erlaube ich mir eben wieder die Frage, ob nicht unverblindet doch die Psychoakustik die Hauptrolle spielt.
solche Aussagen halte ich persönlich für sehr schwierig. Gerade beim längeren, unverblindeten Hören hast Du wieder die volle Bandbreite der Psychoakustik am Start:
- du siehst das Gerät
- du bedienst es
- du kennst die Testberichte
- du willst vielleicht sogar, dass es sich besser anhört
- usw.
Das Gehirn kann einem dabei eine Menge Streiche spielen.
Ausgepegelte Blindtest sind sicher kein Allheilmittel. Man muss sie aber auch nicht unter Zeitdruck und im Akkord durchführen. Wenn man sich dabei Zeit lässt, sollten solche eklatanten Unterschiede wie Du sie nennst, schon erkennbar werden.
Wenn das absolut nicht der Fall ist, dann erlaube ich mir eben wieder die Frage, ob nicht unverblindet doch die Psychoakustik die Hauptrolle spielt.





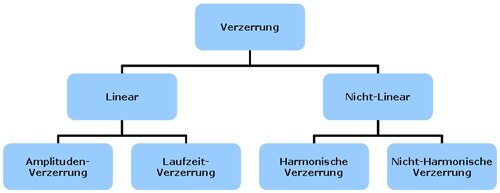
Kommentar